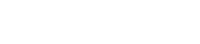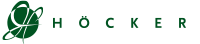Frankfurter Pressesenat untersagt Berichterstattung zu angeblichen Chatnachrichten
Mit Urteil vom 27.03.2025 hat der Pressesenat des OLG Frankfurt am Main (Az.: 16 U 9/23; nicht rechtskräftig) einen vorläufigen Schlussstrich unter eine seit Mai 2018 andauernde äußerungsrechtliche Streitigkeit gezogen. Ein Presseunternehmen hatte damals – ohne vorherige Anhörung – in zwei aufeinanderfolgenden Berichten über angebliche Chatnachrichten unseres Mandanten berichtet. Das Presseunternehmen schrieb unserem Mandanten rechtsextreme und somit maximal rufschädigende Äußerungen zu. Unser Mandant bestritt jedoch von Anfang an, dass diese Nachrichten authentisch seien, was er im vorhergehenden Eilverfahren auch mehrfach an Eides statt versicherte und dabei betonte, dass die streitigen Chatnachrichten manipuliert seien.
Nach insgesamt drei Verhandlungstagen stellte der Senat nun fest, dass die drei Beklagten (das Unternehmen und die jeweiligen Autoren) nicht beweisen konnten, dass die Chatnachrichten authentisch seien – es fehle „am Nachweis, dass diese tatsächlich wahr sind“. Den Beklagten lag lediglich eine sog. html-Datei vor, die von einem Sachverständigen als nicht fälschungssicher und gleich einem einfachen Word-Dokument eingeordnet wurde. Eine solche (nicht signierte) Datei könne jederzeit nachträglich manipuliert werden. Diese Datei hätten die Beklagten von einer Quelle erhalten. Zwar müssten sie diese nicht namentlich benennen. Um eine Zuverlässigkeitsprüfung der Quelle jedoch zu ermöglichen, seien die Beklagten gehalten, Einzelfallumstände offenzulegen, so dass ein Rückschluss auf die Verlässlichkeit des Informanten und die Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Informationen gezogen werden könne.
Dem seien die Beklagten nicht nachgekommen: Da die Quelle die Datei aus einer Straftat erlangt habe (§ 202a StGB), ergäben sich zunächst erhöhte Anforderungen an die Überprüfung der Zuverlässigkeit der Quelle – die Beklagten hatten selbst angegeben, dass die Quelle den Account des Klägers gehackt habe. Vor Übergabe verfügte die Quelle auch rund 4 Wochen über die Datei, was angesichts der im Raum stehenden Vorwürfe der Manipulation eine Überprüfung der Zuverlässigkeit nahegelegt hätte – v.a., da die Beklagten in der Vergangenheit noch nichts mit der Quelle zu tun gehabt hätten und einräumten, um die mangelnde Fälschungssicherheit gewusst zu haben. Das Gericht wies zudem auf mehrere Widersprüche im Vortrag der Beklagten hin. So räumten die Beklagten etwa erst in der Berufungsverhandlung vor dem Senat ein, dass ihre Quelle aus zwei Personen bestand – ein Umstand, der in vorherigen Gerichtsverhandlungen nicht offenbart wurde, was der Senat explizit als „nicht nachvollziehbar“ bezeichnete. Auch weitere Unstimmigkeiten bemerkte der Senat. So trugen die Beklagten im Eilverfahren etwa vor, nicht zu wissen, wer wie an die Datei gelangt sei – ein offener Widerspruch zum Vortrag im Hauptsacheverfahren. Im Ergebnis gelangte das Gericht daher zu der Feststellung, dass die Beklagten – gerade auch im Licht der Schwere der Vorwürfe – nicht den von ihnen zu verlangenden journalistischen Sorgfaltspflichten genügt haben.
Das Gericht hat die Beklagten daher verurteilt, es zu unterlassen, im Zusammenhang mit den streitigen Vorwürfen identifizierend über den Kläger zu berichten. Zudem wurden auch mehr als 20 konkrete Aussagen untersagt. Es wurde ferner festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, dem Kläger materielle Schäden zu ersetzen. Der Senat hat unserem Mandanten (neben der Erstattung von Abmahngebühren) auch eine Geldentschädigung in Höhe von insgesamt EUR 25.000 zugesprochen, da die streitigen Äußerungen eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung bedeuteten. Lediglich bezüglich der beantragten Höhe der Geldentschädigung erfolgte eine Teilzurückweisung durch den Senat. Der Streitwert wurde auf EUR 480.000 festgesetzt; die Revision wurde nicht zugelassen. Hiergegen haben die Beklagten bereits Beschwerde zum BGH eingelegt (Az.: VI ZR 102/25).
Rechtsanwalt Dr. Christian Conrad: „Die Entscheidung stärkt sowohl die Rechte der Betroffenen als auch die der Presse, indem das natürliche Spannungsverhältnis zwischen Informantenschutz und Persönlichkeitsrecht interessengerecht aufgelöst wird. Entgegen erster journalistischer Reaktionen hat der Pressesenat hier kein Neuland betreten, sondern die – von uns beständig betonte – existierende Rechtsprechung zum Schutz von journalistischen Quellen oder etwa zur Beweiskraft von Dateien folgerichtig angewandt. Das Urteil war zudem spätestens seit einem gerichtlichen Hinweis aus Ende Dezember 2024 absehbar.“
Anm.: Die Pressemitteilung des OLG Frankfurt a.M. (Nr. 17/2025) ist hier abrufbar: https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/presse/hohe-anforderungen-an-die-pruefung-der-zuverlaessigkeit-einer-quelle