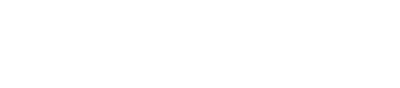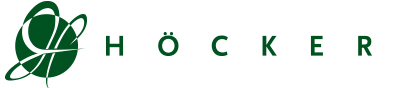Die neue schwarz-rote Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen soll beendet werden. Unter dem Signum des Kampfes gegen „Desinformation“ und „Fake News“ will man härter gegen Lügen, insbesondere in sozialen Medien, vorgehen. Was manchem auf den ersten Blick als sinnvolle Maßnahme erscheinen mag – denn wer will schon belogen werden? –, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als juristisch und demokratisch höchst problematisch.
Was steht im Koalitionsvertrag?
Im Koalitionsvertrag heißt es: „Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hass und Hetze vorgehen können.“
Das neue „Lügenverbot“ richtet sich vor allem an Internetnutzer, aber auch an die Betreiber sozialer Plattformen. Bisher ist die Verbreitung von Lügen nicht grundsätzlich verboten. In einem freiheitlichen Rechtsstaat darf man auch blanken Unsinn erzählen, egal ob man wirklich daran glaubt oder nicht. Einzige Ausnahme: Eine falsche Behauptung darf nicht das Persönlichkeitsrecht einer bestimmten Person verletzen. Nicht einmal unbewusst darf man über Dritte Unwahrheiten verbreiten. Natürlich darf also niemand behaupten, dass zum Beispiel ein anderer vorbestraft sei, wenn das nicht stimmt.
Demnächst soll jedoch auch die bewusste Verbreitung von Falschaussagen ohne direkten Bezug zu einer konkreten Person verboten sein. „Die Erde ist eine Scheibe“, darauf wies mein Kanzleipartner Christian Conrad in dieser Zeitung hin, wäre eine solche Aussage. Wer so etwas sagt, könnte künftig Probleme bekommen, obwohl der Planet Erde keine Persönlichkeitsrechte besitzt und sich durch eine Falschbehauptung über seine Form auch nicht gestört fühlen kann. Hintergrund sind die Gefahren, die nach Auffassung der Koalition mit Fake News verbunden seien. Der Koalitionsvertrag hält hierzu fest: „Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.“
Wer also wider besseres Wissen behauptet, dass die Erde eine Scheibe ist und so Wahlwerbung für eine (hypothetische) „Flacherdler-Partei“ macht, weil diese als einzige die „Wahrheit“ erkenne, nimmt gezielt Einfluss auf Wahlen und kann demnächst wohl sanktioniert werden. Aber auch „alltägliche Desinformation“ scheint ein Problem zu sein, wenn sie den „gesellschaftlichen Zusammenhalt“ bedroht. „Saarländer begehen laut Kriminalstatistik die meisten Straftaten“ wird man demnächst auch außerhalb des Wahlkampfs vermutlich nicht mehr sagen dürfen, um keine spalterisch saarländerfeindlichen Gefühle zu wecken. Denn in Wahrheit gebührt der Spitzenplatz im Kriminalitätsranking dem Land Berlin und seinen Bewohnern.
Doch die Formulierungen im Koalitionsvertrag werfen zentrale Fragen auf: Was genau ist eine „falsche Tatsachenbehauptung“? Was sind „Hass und Hetze“? Wer entscheidet, was eine Lüge ist und was nicht? Und ist es wirklich nötig, die Allgemeinheit beziehungsweise „die Demokratie“ auch vor Falschbehauptungen zu schützen, die keinerlei Persönlichkeitsrechte verletzen?
Was ist eine Lüge? Die Unschärfe des Begriffs der „falschen Tatsachenbehauptung“
In der Theorie lassen sich Tatsachen sehr einfach von Meinungen unterscheiden – Tatsachen sind (grundsätzlich) beweisbar, Meinungen dagegen nicht: „In der Küche des Restaurants leben Kakerlaken“ ist eine Tatsachenbehauptung, die sich verifizieren lässt. Wer so etwas sagt, muss es beweisen können. „Das Restaurant ist nicht gut“ ist hingegen eine Meinungsäußerung, denn es liegt ganz im Auge des Betrachters, ob er ein Restaurant gut findet oder nicht. Wer so etwas sagt, bewegt sich im Bereich der Meinungsfreiheit.
Jeder Medienrechtler weiß jedoch, dass es in der Praxis einen breiten Graubereich gibt, in dem die Abgrenzung von Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen kompliziert werden kann. „Das Essen im Restaurant war zu kalt und das Bier zu warm“ ist ein solches Beispiel. Ab welchen Temperaturen ist ein Essen eindeutig und objektiv messbar zu kalt, und ab welchen ist ein Bier zu warm?
Wenn es schon für Fachjuristen schwierig wird, aus derlei gemischten Äußerungen einen möglicherweise unzulässigen Tatsachenkern herauszudestillieren und diesen vom zulässigen Meinungsanteil zu trennen beziehungsweise einen vertretbaren Beurteilungsspielraum des Äußernden zu definieren, wird es für Laien erst recht heikel. Manch einer wird künftig lieber ganz darauf verzichten, seine Meinung insbesondere zu heftig umstrittenen Themen kundzutun, wenn immer die Gefahr besteht, für echte oder vermeintliche Falschbehauptungen sanktioniert zu werden. Die Schere im Kopf wird die Meinungsvielfalt zur Einfalt verkommen lassen.
Und zweifellos wird die Medienaufsicht auch zulässige Meinungsäußerungen rechtswidrig sanktionieren. Bereits heute geschieht dies immer wieder, wenn etwa eine Landesmedienanstalt die schon bisher geltende Rechtslage überdehnt und Plattformanbieter zwingen will, bestimmte vollkommen legale Postings ihrer Nutzer zu löschen oder jedenfalls aus Deutschland nicht weiter zugänglich zu machen. Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit kämpft vor allem Elon Musks „X“ gegen die überzogene behördliche Regulierungswut und verteidigt auch einzelne Nutzerpostings mit hohem Aufwand vor Gericht gegen die deutschen Landesmedienanstalten, um die Meinungsfreiheit im Netz zu schützen.
Demnächst soll die „staatsferne Medienaufsicht“ mit dem Lügenverbot sogar ein noch viel mächtigeres, weiteres Zensurwerkzeug an die Hand bekommen, um nicht nur die Nutzer, sondern auch die Plattformen noch intensiver gängeln zu können. Auch hier besteht die Gefahr, dass die Plattformen dem Druck nachgeben und Postings in meinungsfeindlicher Weise überregulieren, um bloß keinen Ärger zu bekommen und Gerichtskosten zu sparen.
Die Unschärfe der Begriffe „Hass und Hetze“ – Achtung, Willkürgefahr!
Die Begriffe „Hass und Hetze“, die im Koalitionsvertrag prominent auftauchen, sind vor allem pseudojuristische Floskeln. Mein bekannter Anwaltskollege Joachim Steinhöfel nennt sie „triviale Sprechblasen“, und er hat recht. Die Anwendung derart schwammiger Begriffe öffnet Willkür und Rechtsmissbrauch Tür und Tor und schafft Unsicherheit – sowohl für Bürger als auch für Medien.
„Hass und Hetze“ sind überdies als Anknüpfungspunkt für juristische Sanktionen auch deshalb ungeeignet, weil „Hass“ ein grundsätzlich legitimes menschliches Gefühl und „Hetze“ nur ein besonders negativ konnotiertes Synonym für ebenfalls legales „intensives Schimpfen“ ist. Weshalb sollte man nicht hassen oder hetzen dürfen? Negative Gefühle und beschimpfende Gefühlsäußerungen mögen für den Äußernden ungesund und für den Beschimpften verletzend sein, gehören aber grundsätzlich zu unseren verfassungsrechtlich verbürgten Freiheiten. Denn die Rechte des einen enden nicht dort, wo die Gefühle eines anderen beginnen. Anders formuliert: Nur weil jemand sich durch eine abweichende Meinung gehasst, verhetzt und verletzt fühlt, heißt das nicht, dass er mit seiner Gegenmeinung recht hat und nicht auch harte und härteste Kritik einstecken muss.
Wer definiert die Wahrheit? – Es darf kein „Wahrheitsministerium“ geben
Die zentrale Gefahr eines Lügenverbots liegt jedoch in der Definitionsmacht des Staates oder staatlich beauftragter Behörden. Wer entscheidet, was eine Lüge ist? Christian Conrad warnte in der Berliner Zeitung: „Es kann nicht sein, dass sich der Staat zum Wahrheitsministerium aufschwingt.“
Gerade in politischen und gesellschaftlichen Debatten, an denen der Staat ein besonderes Interesse hat, gibt es selten eine absolute Wahrheit. Was heute als Lüge diffamiert wird, kann morgen als legitime Position anerkannt sein. Wer 2020 behauptete, das Coronavirus stamme aus einem chinesischen Labor, galt als rassistischer Verschwörungstheoretiker. Heute halten Experten die Wuhan-Labortheorie für durchaus plausibel, wenn nicht gar für überwiegend wahrscheinlich.
Dass die laut Koalitionsvertrag angeblich „staatsferne Medienaufsicht“ in solchen Fragen im Übrigen wirklich so staatsfern agieren würde, wird man mindestens mit einem großen Fragezeichen versehen dürfen.
Fazit
Bereits heute gibt es klare gesetzliche Grenzen des Sagbaren: Volksverhetzung, Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung sind strafbar. Die Leugnung des Holocaust ist explizit verboten. Falschbehauptungen über Personen sind ebenfalls verboten. Die Rechtsprechung wägt stets zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten ab. Das muss reichen. Einen darüberhinausgehenden Regelungsbedarf gibt es von Vornherein nicht, auch nicht unter Hinweis auf den „Schutz der Demokratie“. Übrigens gibt es in der Demokratie auch ein Recht auf Irrtum und darauf, dass die Mehrheit falsch entscheidet.
Soweit der Koalitionsvertrag vom beabsichtigten Schutz bedrohter „Institutionen“ spricht, kommen wir dem wahren Grund der schwarz-roten Regelungswut wohl etwas näher. Die künftige Regierung scheint sich vor allem selbst vor lästiger und „unbotmäßiger“ Kritik schützen zu wollen. Dieser Wunsch kann jedoch erst recht keine Rechtfertigung für massive Grundrechtseingriffe darstellen.
Der „dümmste anzunehmende User“, der auch den größten Unsinn glaubt, nur weil der Nutzer ‚sandmännchen08/15‘ ihn in seinem Profil verbreitet, darf im Übrigen niemals zum Maßstab für die Beschneidung von Freiheitsrechten werden. Das gilt erst recht, wenn man berücksichtigt, dass die technologische Entwicklung es inzwischen jedermann ermöglicht, falsche Tatsachenbehauptungen sofort als solche zu erkennen. Community Notes und in soziale Medien unmittelbar eingebundene KI-„Faktenchecker“ wie Grok helfen dabei.
Auch die ohnehin überlastete Justiz sollte mit unsinnigen Verfahren über angeblich demokratiegefährdende Behauptungen nicht noch zusätzlich belastet werden. Ein generelles Lügenverbot ist mit dem Grundgesetz unvereinbar und öffnet der Zensur Tür und Tor. Der Staat soll sich nicht zum Wahrheitsministerium aufschwingen. Die Demokratie braucht offene Debatten, auch über Irrtümer und Provokationen. Staatlich verordnete Wahrheiten kann und darf es nicht geben. Wer die Meinungsfreiheit beschneidet, gefährdet das Fundament unseres demokratischen Rechtsstaats.
Die künftige Bundesregierung sollte daher dringend umsteuern. Die Meinungsfreiheit ist kein Schönwetterrecht – sie gilt auch für unbequeme, provozierende und sogar unsinnige Äußerungen. Wer sie beschneidet, riskiert mehr als nur ein paar Lügen: Er riskiert die Freiheit.
Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst am 18. April 2025 in der Berliner Zeitung.